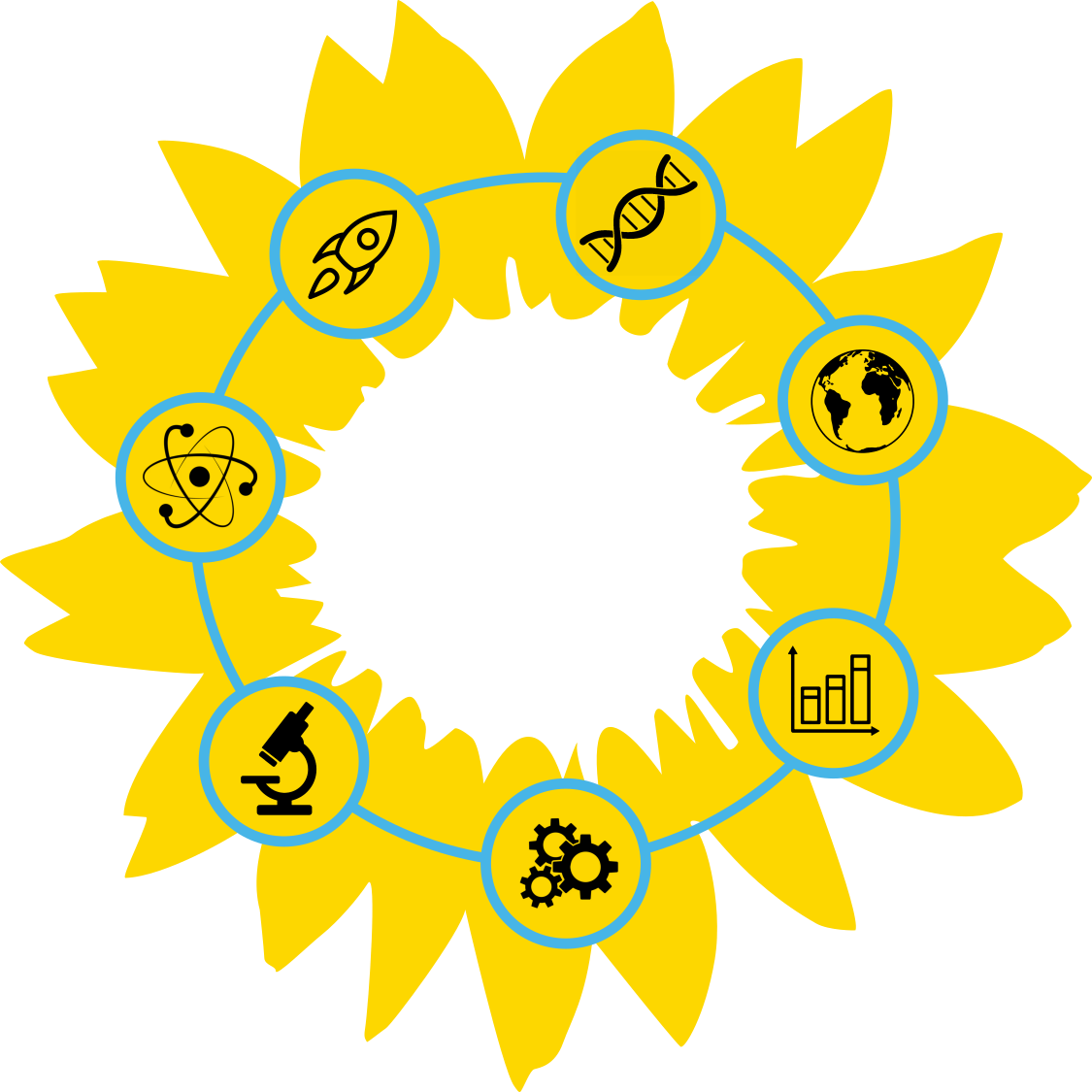Juli 2022, von Dr. Carsten von Wissel
Dem Selbstverständnis nach wären wir Grünen gern die Partei der Wissenschaft. Nicht Machtworte und -interessen sollen den Ausschlag geben, sondern was die Wissenschaft herausgefunden hat. Meistens jedenfalls. Diesem Ideal gerecht zu werden, ist weder trivial noch einfach. Claudia Roths berüchtigte Aussage, „es gibt so’ne und so’ne Wissenschaft“ aus der Homöopathiedebatte, die die Grüne Partei vor zwei Jahren nicht zu führen vermochte, hallen bis heute noch nach.
Solche und andere diskursiven Stolpersteine markieren ungeklärte thematische Referenzen und unbemerkte Pfadabhängigkeiten. Denn oft scheint es den Beteiligten gar nicht mehr in den Sinn zu kommen, einer quasi identitären Verblendung gleich, bestimmte Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln zu thematisieren. So vergibt sich aber die politische Partei mitunter der Chance, bestimmte Fragen überhaupt erst zu stellen. Ohne Diskussion läuft man aber Gefahr, von politischen Entscheidungen jenseits des eigenen parteipolitischen Tellerrandes überrascht zu werden. Aktuell ist das bei der sog. Taxonomie so, die Nuklearenergie und Gasverbrennen als nachhaltige Modi der Energieerzeugung ausweist und damit energiepolitischen Sichtweisen, die außerhalb Deutschlands hochgehalten werden, folgt. Aus einer deutschen Bündnisgrünen Perspektive scheint das absurd. Hier war das Thema Kernenergie schlicht erledigt und gilt als abgeräumt.
Die Frage, ob es zwingend ist, vor den Kohlekraftwerken die nuklearen Kraftwerke abzuschalten, oder, ob man es nicht besser anders herum angehen sollte, stellt sich den Grünen hierzulande gar nicht erst. Aber woanders, in Frankreich, in Finnland, ist das anders. Die schwarzen Löcher im grünen Diskurs haben mitunter ein großes Überraschungsmoment, wenn Akteuren in der Partei auffällt, dass Nukleartechnik gar nicht verschwindet oder das Thema Kernfusion immer noch nicht erledigt ist und immer noch am ITER gebaut wird. Und hinter dem Unausgesprochenen verbirgt sich oft Verdrängtes, Halbvergessenes und Beiseitegeschobenes aus dem Setzkasten parteilicher Identitätsdiskurse, darunter leidet auch immer wieder ein Bezug auf Wissenschaftspolitik bzw. Wissenschaftsfreiheit. Deshalb möchte ich im Folgenden aufdröseln, welche gedanklichen Stränge dafür verantwortlich sind, dass Wissenschaftspolitik bis heute ein randständiges Thema in Grünen Diskurs geblieben ist und warum Wissenschaftspolitik für die Grüne Partei ein kompliziertes Gebiet markiert, bei dem heimelige Wärme nicht recht aufkommen will und was das alles mit der deutschen Atompolitikgeschichte zu tun hat.
Zuerst werde ich die historisch/parteigeschichtliche Dimension unter die Lupe nehmen, um ein Verständnis davon zu gewinnen, welche Pfadabhängigkeiten hier wirken. In einem zweiten Teil wird es um die politiksemantische Problemlage gehen. Ich beantworte die Frage, was Wissenschaftspolitik eigentlich genau ist. Im dritten Teil gehe ich auf eine Metaebene und werde danach fragen, was die epistemischen Herausforderungen sind, vor denen Grüne Wissenschaftspolitik heute steht.
Historisch/parteiwissensgeschichtliche Dimension
Eins der im heutigen BMBF aufgegangenen Ministerien heißt erst seit Dezember 1962 Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung, davor hieß es Bundesministerium für Atomfragen, Bundesministerium für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft und Bundesministerium für Atomkernenergie. Diese Namensgeschichte des Hauses zeigt, dass in den frühen Jahren der Republik Wissenschaftspolitik engst mit Atompolitik verbunden war und zwar so eng, dass der atompolitische Bezug das Argument lieferte, um dafür ein eigenes Ministerium einzurichten. Das war also die Urgeschichte der bundesrepublikanischen Wissenschaftspolitik. Vermutlich war es damals auch für Wissenschaftspolitikfunktionäre eine attraktive Option, sich der nuklearen Technologie zuzuwenden, weil es dort viel Geld gab und viel politische Anerkennung zu gewinnen war. Und im Nachhinein kann man ja nicht sagen, dass der deutsche Atompolitikbetrieb leistungsschwach gewesen wäre, von der Einrichtung des Bundesministeriums bis zur Inbetriebnahme des ersten kommerziellen AKWs brauchte er nur sechs Jahre. Aus Perspektive einer Zeit, in der es 20 und mehr Jahre benötigt, um den Zulauf zu den Alpenunterquerungen zu schaffen, sieht das geradezu atemberaubend schnell aus und zeigt, dass damals im vollsten Sinne des Wortes viel Druck auf dem Kessel war.
Die Verbindungen von Atom- und Wissenschaftspolitik waren also eng, sehr eng und Wissenschaftspolitik im Nachkriegsdeutschland war stark im Kraftfeld von Energie- und Technologiepolitik gefangen. Es ist vermutlich reiner Zufall, dass Ernst-Ludwig, Sohn des vormaligen IG-Farben-Managers und SA-Mitglieds Karl Winnacker war, welcher gemeinsam mit dem Coautor Karl Wirtz eine Art Bestseller über deutsche Atompolitik vorgelegt hatte. Später, 1998 bis 2006, war Winnacker Präsident der DFG. Das zeigt, dass die Tiefenwurzeln bundesrepublikanischer Wissenschaftspolitik nicht unbedingt in der Demokratie verankert waren.
Gegen derlei Ende der 1970er Jahre noch sehr gut erinnerbare Konstellationen rannte die Grüne Politik der frühen Jahre an. Man verschrieb sich nachvollziehbarerweise dem Ziel, Wissenschaftspolitik durch aufgeklärte Gegenexpertise zu stärken. Und dieser Sonderweg war erfolgreich. Ab 1980 entstand eine andere Art anwendungsbezogene wissenschaftliche Forschung (s.“ so’ne und so’ne Wissenschaft“), eine Forschungsinfrastruktur, die anders, oft aber erstmals, auf Umwelt- und Energiepolitikthemen schaute. Diese war keine Gegenwissenschaft, eher eine komplementäre Wissenschaft, weil sie bis dahin unbearbeitete Lücken im Forschungssystem füllte. Lücken, die dieses bis dahin zum Teil nur zögernd und widerwillig bearbeitete, wie die Geschichte des Max Planck Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich technischen Welt zeigte und es gibt diese sozialökologische Forschung immer noch, nur ist sie heute zum Glück keine Gegenwissenschaft mehr, sondern etablierter Teil des Wissenschaftssystems. Sie ist immer noch in Teilen nichtstaatlich organisiert (s. das Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt, das Berliner IÖW, Ecologic oder das Freiburger Öko Institut) und demzufolge hochgradig projektifiziert, aber im Laufe der Jahre auch im staatlichen Wissenschaftssystem institutionalisiert, z. B. in Form des Wuppertal-Instituts.
Damit war für die Grüne Partei eine wissenschaftspolitische Wahrnehmung etabliert. Im innergrünen Diskurs verfestigte sich das einmal erlernte Muster, Wissenschaft politisch einzusetzen. Es wiederholte sich bei der Gentechnik. Eine tiefe Skepsis gegenüber Etabliertem und eine gewisse politikfeldspezifische Distanz pflanzten sich fort. Als kleine Partei fehlten zudem Leute, die sich mit dem Politikfeld Wissenschaftspolitik identifizierten. So blieb das Politikfeld über lange Jahre eher eins der anderen Parteien. Nur in sehr großstädtischen Landesverbänden mit vielen großen Universitäten (insbesondere Berlin) gab es ab dem Ende der 1980er Jahre einzelne Abgeordnete, die sich mit dem Thema kompetent befassten. Die fachpolitischen Netzwerke blieben allerdings diejenigen der anderen Parteien.
Die letztgenannte Verschränkung ist tief in deutscher Wissenschaftspolitikgeschichte verwurzelt. Wissenschaftspolitik in Deutschland war sehr, insbesondere auch im historischen Vergleich sehr staatsnah. Anders als in den USA gab es in Deutschland so gut wie keine aus der Zivilgesellschaft motivierten Universitätsgründungen. Deutsche Universitäten und Hochschulen waren einerseits Beamtenausbildungsstätten, später in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts als Technische Hochschulen oder Bergakademien waren sie sehr wirtschaftsnah. Und so ist es auch kein Zufall, dass die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft die 1920 entstandene Vorgängereinrichtung der DFG, deren Aufgabe es war, einen der „wenigen dem deutschen Staat verbliebenen Aktivposten“ zu entwickeln, gleichzeitig mit einem von der Wirtschaft finanzierten Stifterverband der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft gegründet worden ist.
Begriffsgeschichtlich-semantische Problemdimension
Was genau Wissenschaftspolitik ausmacht, ist für Außenstehende nicht klar umrissen. Ist sie Hochschul-, Forschungs-, Bildungs-, Technologie- oder Innovationspolitik? Aus dieser Unbestimmtheit resultiert eine Gemengelage an Erwartungen. In welcher Nachbarschaft siedelt man die Wissenschaftspolitik am besten an? Auch hier gibt es keine Einfürallemalantworten. Hinzu kommen eine Vielzahl von Akteuren und Interessengruppen, die sich in den verschiedenen Arenen der Wissenschaftspolitik tummeln.
Bei Hochschulpolitik geht es primär um das Innere von Organisationen, ihre Demokratisierung und wie man sie gestaltet. Mitbestimmungs- und Selbstverwaltungsaspekte überlagern einander, verschiedene Status- und demzufolge Interessegruppen beargwöhnen einander. Forschungspolitik hingegen setzt den Rahmen von gesellschaftlicher Wissensproduktion ist aber noch mehr eine haushalterisch steuernde Politik, nicht zuletzt, weil Wissenschaft ähnlich wie Kunst nicht angewiesen werden kann: Also werden hier Budgets gesetzt und Programme aufgelegt. Das ist aus Sicht Unbeteiligter allzu oft ein langweilig anmutendes Geschäft. Aber diese Langweiligkeitsanmutung des Politikfeldes wird auch allzu oft und gern von Akteuren der Wissenschaftspolitik auf Landesebene genutzt, um eine jeweils lokalspezifische Mischung von Standortpolitik und Schutz etablierter Interessen zu gewährleisten.
Es kommt hinzu, dass Wissenschaftspolitik sowohl als Hochschul- als auch als Forschungspolitik auf den ersten Blick nicht die gesamte Gesellschaft zu betreffen scheint, sondern nur Studierende, Mitarbeiter*innen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler*innen. Interessant für viele wird sie als eine Art Zulieferpolitik für andere Felder. D. h. Ökonom*innen interessieren sich für Innovation (in einem durchaus technisch engeren Sinne), Ökos interessieren sich für Umweltforschung, Energieleute für Ingenieurwissenschaften in ihrem Feld. Originär wissenschaftspolitische Themen wie die Forschungsfreiheit sind diesen Gruppen eher nachgeordnete Themen, deren Bearbeitung man gern der Wissenschaftspolitik überlässt. Parteiinterne Konflikte um wissenschaftsrelevante Fragen wie Regulierung von Gentechnik, Tierversuche und ähnliche sind dann durch den parteiinternen Diskurs strukturiert und der ist anders gestrickt als der wissenschaftspolitische. So kommt, was Tierversuchsfragen betrifft, der innergrüne Diskurs regelmäßig zu anderen Ergebnissen und Gewichtungen als der wissenschaftspolitische mit seiner starken Basierung auf Verwaltungsrecht und theoretisch hergeleiteten Konzeptualisierungen von Wissenschaftsfreiheit. Originär für das wissenschaftliche Feld relevante Belange werden darum durchaus anders gewichtet.
Schließlich gibt es ein Politikfeld, das auf den Schultern von Wissenschaft steht: die Bildungspolitik. Sie betrifft einerseits gesellschaftliche Wissensordnungen und andererseits die Zu- und Verteilung von Lebenschancen. Betroffen sind da alle und sehen das auch so. Das hat Vor- und Nachteile zugleich, denn fast alle fühlen sich kompetent, bei Bildungsangelegenheiten mitzureden. Hochschulen gehören auch zum Bildungssystem. In anderen Hochschulsystemen, z. B. den angloamerikanisch geprägten, lässt sich mit Recht sagen, dass das undergraduate-Studium zum Erziehungs- bzw. Bildungssystem gehört. Diese Zuordnung hat Folgen für den hochschulpolitischen Diskurs und für Erwartungen, die an die Organisationen adressiert werden. Auch in Europa verschieben sich im Zuge der Einrichtung von Bachelor-Studiengängen und der quantitativen Ausweitung der Hochschulbildung die Hochschulen in Richtung Erziehungssystem. Immer häufiger ist im Zusammenhang mit dem Studium von Ausbildung, einer Unterform von Erziehung die Rede. Diese Tendenz wird möglicherweise durch die Abkehr von G8 etwas gedämpft, aber der Trend dürfte unaufhaltsam sein. In dem Maße, in dem eine Hochschul(aus)bildung zur Regel wird und 50 % eines Jahrganges erreicht und nicht mehr nur 5 % der Männerjahrgänge betrifft, wird ein (Aus-)Bildungsauftrag unausweichlich bedeutsam.
Epistemische/epistemisierungsgetriebene Problemdimension
Zukunftszugewandte Wissenschaftspolitik muss sich sowohl in den Dienst gesellschaftlich relevanter Problemlösungen stellen als auch die Wissenschaftsfreiheit gegen Ansprüche anderer Politikfelder verteidigen. Einerseits werden von der Wissenschaft zu erwartende Problemlösungen überall gebraucht, andererseits gilt, dass von freier Wissenschaft umso mehr zu erwarten ist, dass sie Erträge erbringt. Zweiteres war eine Reaktion auf Erfahrungen zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Insofern ist es keineswegs so, dass Orientierung an Wissenschaftsfreiheit bedeutet, Wissenschaft jenseits einer Orientierung an gesellschaftlichen Relevanzen zu betreiben, vielmehr zielt sie darauf ab, dass wissenschaftliche Relevanz nicht kurzfristigeren politischen oder gesellschaftlichen Interessen zum Opfer fällt. Wissenschaft ist somit als eine am Gemeinwohl orientierte Gegenöffentlichkeit zum Politischen konzeptualisiert und die damit verbundene Spannung ist gerade für demokratische Gesellschaften konstitutiv.
Zunehmende Verwissenschaftlichung des Politischen lässt sich damit auch als (anschwellende) Rationalitätskontrolle im politischen Prozess beschreiben. Damit das so sein kann, ist es unabdingbar, dass Wissenschaft wissenschaftlich orientiert bleibt und dass eine Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Politik aufrechterhalten wird. Ein unreflektiert politisches Follow the Science kann leider das genaue Gegenteil dessen hervorbringen, was es erreichen soll oder erreichen zu wollen vorgibt: Wissenschaft würde geschwächt sein und nur noch als verlängerter Arm des Politischen wahrgenommen werden, eine epistemischer Zusammenhalt der Gesellschaft stünde damit auf der Kippe. Dabei ist die Frage, ob es wirklich, eine von Macht und Einflussnahme freie Wissenschaft gibt, unerheblich (Spoiler: Es gibt sie nicht, weil es kein Denken im herrschaftsfreien Raum gibt), dies ist aber kein Argument dafür, diesen Anspruch aufzugeben. Entscheidend ist vielmehr die Orientierung an diesem Ideal. Aus der Unwahrscheinlichkeit, tatsächlich herrschaftsfrei und unabhängig von sozialen Verortungen zu denken, folgt demnach nicht, dass es sinnlos oder gar kontraproduktiv wäre, wissenschaftliche Praxis an solch einem Ideal ihrer Freiheit zu orientieren.
Dennoch gibt es Verschiebungen im Verhältnis von Wissenschaft und Politik.
Einerseits wird in immer mehr Politikfeldern wissenschaftliches Wissen wichtig (auch im Sinne der oben angeschnittenen Rationalitätskontrolle), anderseits gibt es auch Verschiebungen im Verhältnis von Politik und Wissenschaft zueinander. Wissenschaftliche Ergebnisse ignorierende Politik lässt sich immer weniger rechtfertigen, so dass der Eindruck entstehen kann, der Raum des Politischen würde enger, nicht zuletzt auch deshalb, weil Wissenschaft und ihre Praxen nicht in allen Segmenten der Gesellschaft gleich vertreten sind. Damit sind einerseits Kränkungen derer verbunden, die an ihnen nicht teilhaben können (oder wollen). Es werden Menschen ausgeschlossen, die nie mit wissenschaftlichen Diskursen in Berührung gekommen sind und diese fühlen sich ausgeschlossen und an den Rand gedrängt (letztere haben sich in den letzten Jahren immer wieder mal dem Rechtspopulismus zugewandt, weil der ihnen Erlösung vor diesen Zumutungen versprach). Für die Demokratie kann sich diese Nichtrepräsentanz zu einem handfesten Problem auswachsen. Die rechte Mobilisierung gegenüber der Wissenschaft legt hier schon ein beredtes Zeugnis ab.
Fazit: Was das für Grüne Politik heißt
Zum ersten muss sich Grüne Politik der Geschichte und Genese ihrer eigenen Wissenschaftspolitikgeschichte bewusst sein. Hilfreich wäre es, wenn die Partei sich vergegenwärtigen würde, dass in der Reproduktion von in der Auseinandersetzung mit dem nuklearen Komplex eingeübten Mustern keine allgemeinen Antworten liegen, wie forschungs- und wissenschaftspolitische Fragen zu beantworten sind. In selbstgeschaffene Pfadabhängigkeiten hineinzustolpern ist zumindest keine Lösung und eine Hypothek für das Verhältnis zur Scientific Community. Auch ist nicht davon auszugehen, dass Fragen von Fortbestand oder Verschwinden von Forschungsfeldern und Technologien in der Hand der Politik liegen. Daraus, dass es in Deutschland (und bis auf weiteres fast nur hier) gelang, eine Technologie zu erledigen, lässt sich nicht folgern, dass es gelingen kann und soll, andere Technologien verschwinden zu lassen.
Dann muss die Partei das Spannungsverhältnis aus Hochschul- und Wissenschaftspolitik integrativ ausbalancieren. Einerseits schulden wir den Menschen im Wissenschaftssystem vernünftige Arbeitsbedingungen und berechenbarere Karriereperspektiven, andererseits schulden wir der Gesellschaft eine Wissenschaft, die den großen gesellschaftlichen Herausforderung begegnet. Daraus ergeben sich Anforderungen an eine Forschungsprogrammierung, bzw. daran, wie Forschungsprogramme zustande kommen sollen. Hier stände es den Grünen gut an, die Partei des öffentlichen Diskurses zu ergreifen und transparent darüber sowie dafür zu streiten, wie, bzw., dass Politik ihre Fragen an Wissenschaft adressieren soll.
Der dritte Komplex ist womöglich der am wenigsten einfache. Denn hier wird deutlich, dass Verschiebungen im Verhältnis von Wissenschaft und Politik auch grüne Politik mit der Aufgabenstellung konfrontieren, sich in einigen Fragen neu auszurichten. Wenn Wissenschaftsorientierung zu einem konstitutiven Moment des Demokratischen wird, dann kann eine taktische wissenschaftspolitische Ausrichtung, ein nur aufgesagtes „Follow the Science“ keine Option mehr sein. Wir können und dürfen die Wissenschaft, die uns gefällt oder gerade wichtig erscheint, nicht gegen eine andere Wissenschaft ausspielen. Wir müssen stets damit rechnen, dass durch politische, gesellschaftliche oder wissenschaftliche Entwicklungen plötzlich irgendeine Wissenschaft, die wir bislang für unwichtige hielten, wichtig wird. Deshalb ist Relevanz des Tages kein besonders guter wissenschaftspolitischer Leitstern.
Der letzte Aspekt ist mir insbesondere deshalb wichtig, weil die Ereignisse dieser Wochen, zum Monatswechsel Februar zu März 2022, den Vorschein schlimmer haushalterischer Zumutungen aufscheinen lassen. Mit anderen Worten, viel Geld für Wissenschaft auszugeben, wird in den kommenden Jahren möglicherweise nicht wie eine besonders naheliegende Idee aussehen, es sei denn es gelingt, eine Art Wiedergänger des Manhattan-Projekts aufzulegen und gesellschaftlich zu installieren. Ich würde sehr viel darum geben, dass der Anlass dieses Projektes der Klimawandel ist und nicht eine Systemauseinandersetzung mit China.
In beiden Fällen wird die Frage der Verbindung von Wissenschaft und Demokratie im Mittelpunkt stehen. Eine näher an die Politik gerückte Wissenschaft wird in Hinblick auf ihre Demokratizität befragt werden müssen, d. h. es wird, wie im Recht um den Demokratiebezug von Wissenschaft gerungen werden müssen, gerade weil Wissenschaft selbst zunächst erstmal kein demokratisch, sondern ein meritokratisch strukturiertes Unterfangen ist. Und noch aus einem zweiten Grund ist es wichtig, Demokratizität von Wissenschaft in einem sich epistemisierenden Politikbetriebs in den Blick zu nehmen: Mit China tritt ein Akteur auf die Weltbühne, der ein Wissenschaftssystem auf systematisch nichtdemokratischer Grundlage weiterentwickelt und es gibt einigen Unwillen aus den Tiefen wissenschaftspolitischer auch von Organisationsinteressen angeleiteten Diskurses, sich der Problematik nichtdemokratischer Gegenüber zu stellen. In den demokratischen Gesellschaften des Westens müssen wir lernen, wie wir mit einem solchen Wissenschaftssystem umgehen wollen bzw. müssen.